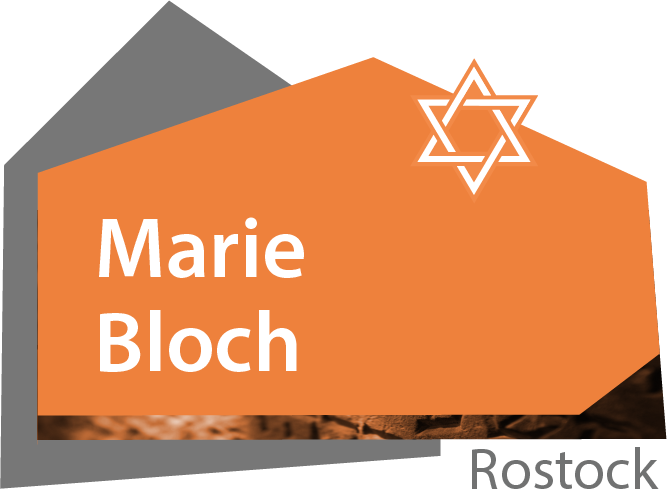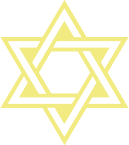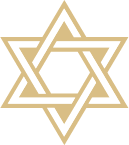Zum historischen Kontext der Lebensgeschichten vor 1933
Die hier versammelten Lebensgeschichten wollen jüdisches Leben in Mecklenburg und Vorpommern vor 1933 zum Sprechen bringen. Den Ansporn hierzu bot der Projektgruppe ein Besuch in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem: Die beeindruckende Begegnung mit Zeugnissen der Vielfalt jüdischen Lebens in Europa bis zu seiner weitreichenden Auslöschung durch den nationalsozialistischen Völkermord ließ den Wunsch keimen, Lernenden auch in der eigenen Region einen Blick auf die Normalität jüdischen Lebens vor der NS-Zeit zu eröffnen. Doch war dieses Vorhaben angesichts der geschichtlichen Entwicklung in Mecklenburg und Vorpommern von Beginn an von einer Sorge begleitet: Könnten Antisemiten ihre Klischees bestätigt sehen, wenn sie auf die hier versammelten Biografien von Kaufleuten, Gewerbetreibenden, Fabrikbesitzern und ihren Familien schauen? Hätte der Blick nicht leicht über die Grenzen des heutigen Bundeslandes hinaus geweitet werden können auf die nächsten Großstädte, um ganz andere jüdische Gruppen hervortreten zu lassen – Hamburgs sefardische Juden etwa, oder die ganz unterschiedlichen jüdischen Milieus, die seit dem 19. Jahrhundert in der Weltmetropole Berlin entstanden? Die Entscheidung fiel anders. Der Blick sollte auf der Region verweilen, und damit galt, was stets gilt, wenn die Geschichte des Nahraums beleuchtet werden soll: Es muss deutlich werden, wo sich allgemeine Entwicklungen in ihm spiegeln, es muss aber ebenso klar hervortreten, wo eigene Wege genommen werden.
Dies gilt insbesondere für Mecklenburg und Vorpommern, wo die jahrhundertealte Geschichte der Benachteiligungen und Verfolgungen von Juden in mancherlei Hinsicht noch deutlicher zu greifen ist als anderswo in Deutschland und Europa. Bestes Beispiel dafür ist der Blick auf die mittelalterliche Entwicklung. Im 13. Jahrhundert entstanden zwischen Elbe, Oder und Ostsee Städte mit deutschsprachiger Bevölkerung. Mit der Stadtkultur kam die Schrift in die Region, und schon in den frühen städtischen Schriftzeugnissen werden auch Juden erstmals greifbar (unter anderem 1266 in Wismar oder 1282 in Stralsund). Sogleich erweisen sie sich nicht nur als religiös, sondern auch rechtlich und sozial abgesonderte Gruppe, die hier wie überall im europäischen Mittelalter die allfälligen Benachteiligungen, Ausgrenzungen, Berufsverbote und Kennzeichnungspflichten zu erdulden hatte. Ein markantes Ereignis steigert diese allgemeine, bis hin zu Verfolgung und Vernichtung reichende Tendenz in der hier betrachteten Region ins Extreme: 1492 kam es infolge eines angeblichen Hostienfrevels im mecklenburgischen Sternberg zu einem Schauprozess. Im Anschluss an ein blutiges Strafgericht wurden alle Juden aus Mecklenburg vertrieben, das Land blieb ihnen bald zwei Jahrhunderte verschlossen und wurde auch bewusst von ihnen gemieden.